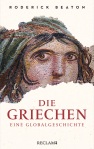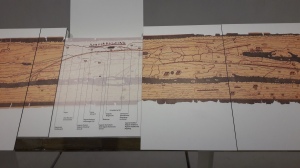Zu den Meisterwerken der etruskischen Kunst gehören die Wandmalereien der Monterozzi-Nekropole von Tarquinia in der italienischen Provinz Viterbo. Die Nekropole zieht sich über etwa 5 Kilometer hin und umfasst mehr als 6000 Grabanlagen von der Villanova-Periode (9. Jahrhundert v. Chr.) bis zur Römerzeit. Wandmalereien befinden sich dagegen nur in etwa 60 dieser Gräber.
Entsprechend der langen Benutzung der Nekropole gibt es hier unzählige Grabtypen. Aus der frühesten Zeit stammen einfache aus dem Fels gehauene Gruben für Brandbestattungen. Als sich gegen Ende des 8. Jahrhunderts v. Chr. eine Aristokratie in Tarquinia etabliert hatte, entstanden die ersten Familiengräber in Form von unterirdischen Grabkammern, über denen sich Grabhügel erhoben. Von diesen teilweise riesigen Grabhügeln, von denen noch im 19. Jahrhundert viele sichtbar waren, ist inzwischen kaum noch etwas übrig und so präsentiert sich die Nekropole dem Besucher heute als flache Ebene.
In den Gräbern standen Urnen oder Sarkophage für die sterblichen Überreste der Verstorbenen. Bei den frühesten Sarkophagen ist eine Skulptur der oder des Verstorbenen auf dem Rücken liegend auf dem Deckel dargestellt. Später zeigen die Skulpturen ihn oder sie auf der linken Seite liegend. Sie wenden sich dem Betrachter zu und halten oft ein Trankopfergefäß in der Hand. Manchmal entfaltet sich bei einem Mann eine Schriftrolle in seiner Hand, auf der seine Ahnen und seine Ämter aufgelistet sind.
Die Seiten der Sarkophage zeigen Reliefs mit symbolischen oder mythologischen Darstellungen. Die Vorbilder für diese Sarkophage stammen vermutlich aus Süditalien, genauer aus der Gegend von Tarent. Hergestellt wurden sie aber wohl in Tarquinia selbst. Zumindest wurden hier sehr viele dieser Sarkophage gefunden.
Man gab den Toten persönliche Gegenstände mit ins Grab und einige Kammern schmückte man mit beeindruckenden Wandmalereien. Man sieht Dämonen und Szenen aus der Unterwelt, fantastische Wesen und Tiere wie Leoparden oder Delphine. Unter den Darstellungen finden wir auch Bankett- und Familienszenen, die uns einen Einblick in das Leben der wohlhabenden Etrusker geben. Ob diese Szenen allerdings tatsächlich im Diesseits spielen oder Jenseitsvorstellungen darstellen, muss offenbleiben.
Unter den vielen sehenswerten Grabanlagen Tarquinias möchte ich im Folgenden ein paar hervorheben. Um die kostbaren Wandmalereien zu schützen, kann der Besucher die Kammern mit den Wandbilder nicht betreten, sondern muss sich mit einem Blick durch Glasscheiben begnügen – die jedoch oft durch die feuchte Luft beschlagen sind.
Die Tomba dei Giocolieri („Grab der Jongleure“) aus dem Ende des 6. Jahrhunderts zeigt im hinteren Giebelfeld einen Löwen und einen Panther. In der Wandzone darunter sind Akrobaten, Jongleure, Musiker und Tänzerinnen dargestellt.
Das Grab des Kriegers (Tomba del Guerriero) ist über einen sogenannten Dromos zugänglich ist. Hierbei handelt es sich um einen Korridor unter freiem Himmel. Die Decke zeigt ein schachbrettartiges Muster und an den Wänden sind sechs rote Säulen dargestellt. Eine Bankettszene zeigt unter anderem zwei Zither- und Doppelflötenspieler, eine Tänzerin und zwei Tänzer.
Die Tomba della Caccia e Pesca („Grab der Jagd und der Fischerei“) ist eines der bekanntesten Gräber Tarquinias. Ein Dromos mit einer Treppe führt zu der Grabkammer, die eine der detailreichsten Wandmalereien der Nekropole besitzt. Zum einen sieht man ein Boot mit Steuermann, Matrosen und einem Fischer inmitten von Delfinen und Vögeln. Zum anderen sind an Land Jäger mit Steinschleudern und ein weiterer Fischer mit einer Harpune dargestellt.
Auch die Tomba dei Tori („Grab der Stiere“) betritt man über einen Dromos. Die Grabanlage besteht aber nicht nur aus einer einzigen Kammer. Der Dromos endet in einer Art Atrium, von dem zwei Kammern abgehen. Von den Stieren, die dem Grab seinen Namen gab, hat einer einen menschlichem Kopf. Vermutlich ist hier der Flussgott Acheloos gemeint. Was das Grab allerdings noch bekannter gemacht hat, sind einige erotische Szenen. Der Besitzer des Grabes, Arath Spuriana, hat sich in einer Inschrift auf dem Architrav verewigt. Er gehörte wohl zu einer der wichtigsten Familien Tarquinias, der Famile Spurinna.
Die Fresken der Tomba degli Auguri („Grab der Auguren“) werden auf die Jahre 530–540 v. Chr. datiert. An der rechten Wand steht ein Mann vor dem Eingang zur Unterwelt. Er trägt ein purpurrotes Gewand und ein Diener übergibt ihm eine sella curulis, einen Klappstuhl, der höheren Beamten vorbehalten war. Neben dieser Szene ist ein Ringkampf dargestellt, beobachtet von einem Ringrichter, wie sein gebogener Stock zeigt. Es handelt sich wohl um eine Szene aus den Begräbnisspielen zu Ehren des Verstorbenen, denn man sieht auch phersu, eine maskierte Gestalt, die einen Hund an der Leine führt, der wiederum eine weitere Person mit verhülltem Kopf angreift.
Die Tomba dei Leopardi („Grab der Leoparden“) ist ein besonders schönes Beispiel der etruskischen Grabmalerei. Zwei Leoparden im Giebelfeld der Rückwand haben dem Grab seinen Namen gegeben. Drei Paare haben sich zu einem Bankett versammelt und liegen auf Klinen. Das mittlere Paar wird von zwei nackten jungen Männern bedient. Das Bankett wird begleitet von Musikanten und Tänzern.
Schon diese wenigen Beispiele der eindrucksvollen, farbenfrohen Fresken der Monterozzi-Nekropole machen deutlich, dass diese Totenstadt ein Muss für jeden ist, der sich für die Etrusker interessiert.